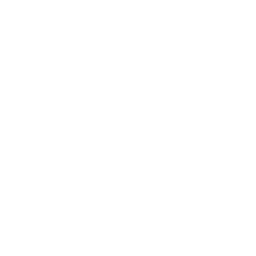20 Jahre Mutterschaftsversicherung – im Windschatten der Elternzeit
Vor 20 Jahren wurde die nationale Mutterschaftsversicherung eingeführt. Trotz seiner international gesehen vergleichsweise kurzen Dauer ist der Mutterschaftsurlaub inzwischen breit akzeptiert. Umstrittener sind dagegen die Vorstösse für eine nationale Elternzeit, welche zurzeit das Parlament behandelt beziehungsweise für die Unterschriften gesammelt werden.
Heute vor 20 Jahren ist die nationale Mutterschaftsversicherung in Kraft getreten. Diese heutzutage breit akzeptierte Entschädigung im Schweizer Sozialversicherungssystem wurde als einheitliche Minimallösung zum Schutz aller erwerbstätigen Frauen geschaffen. Bis dahin unterschieden sich nicht nur die Leistungen, sondern auch die Branchen. Während frauendominierte Branchen einen höheren Teil der Kosten trugen, kannten männerdominierte Branchen teilweise keine Mutterschaftsversicherung.
Erst 60 Jahre später eingeführt
Bereits 1945 hatte die männliche Stimmbevölkerung dem Bund den Verfassungsauftrag zur Einrichtung einer Mutterschaftsversicherung erteilt. Nach jahrzehntelangen Forderungen und politischem Seilziehen sprachen sich schliesslich 56 Prozent der Stimmberechtigten für eine Änderung der Erwerbsersatzordnung (EO) aus, die erwerbstätigen Müttern nach der Geburt eine Lohnfortzahlung von 80 Prozent ihres bisherigen Lohns garantiert. Diese Finanzierung über die EO, für die seit 1940 auch Frauen Beiträge entrichteten, dürfte der Vorlage auch zum Erfolg verholfen haben. Im Gegensatz zu einem obligationenrechtlich geregelten Mutterschaftsurlaub versprach diese Lösung sogar eine finanzielle Entlastung der Arbeitgebenden.
Kein Vorzeigebeispiel
Die Schweiz hat die Mutterschaftsversicherung im internationalen Vergleich sehr spät eingeführt. Auch in punkto Länge ist sie am Ende der Liste der OECD-Länder zu finden. Lediglich in Mexiko dauert der Mutterschaftsurlaub mit 12 Wochen weniger lang – die USA mal ausgenommen, die gar keine Mutterschaftsversicherung kennt. Wenig überraschend also, dass mehr als die Hälfte der Mütter länger als 14 Wochen zu Hause bleibt und den Mutterschaftsurlaub verlängert.
Weitere Urlaubsregelungen eingeführt
In den vergangenen Jahren sind zusätzliche Urlaubsregelungen hinzugekommen. So wurden 2021 der Vaterschaftsurlaub und 2023 der Adoptionsurlaub eingeführt, die jeweils zwei Wochen dauern und deren Bezugsberechtigte die Abwesenheit tage- oder wochenweise gestalten können. Und als erster Kanton stimmte Genf 2023 einer sechswöchigen Elternzeit zu, wurde allerdings vom Bund zurückgepfiffen, weil diese noch nicht mit geltendem Bundesrecht vereinbar ist. Allerdings haben einige Kantone inzwischen die Einführung einer Elternzeit auf Bundesebene gefordert.
Pragmatische und politisch mehrheitsfähige Lösung gesucht
So verlangten zwei Standesinitiativen der Kantone Wallis und Tessin eine Elternzeit von mindestens 20 Wochen und schrieben damit verbindliche Mindestbedingungen vor. Dies war den beiden Kammern zu streng: Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat in der abgelaufenen Sommersession den beiden Initiativen mit 104 zu 80 Stimmen bei 4 Enthaltungen keine Folge gegeben – die beiden Vorstösse sind damit vom Tisch. Empfänglicher zeigte sich das Parlament dagegen für die zwei thematisch ähnlichen Standesinitiativen der Kantone Genf und Jura. Nach ihrer Schwesterkommission hat nun auch die nationalrätliche Gesundheitskommission (SGK-N) grünes Licht gegeben, um einen Gesetzesentwurf zur Einführung eines Elternurlaubs auf Bundesebene zu erarbeiten. Sie hat den Standesinitiativen mit 15 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung beziehungsweise mit 14 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung Folge gegeben. Die allgemein und offen gehaltenen Formulierungen der beiden Initiativen lassen den nötigen Handlungsspielraum für die Ausarbeitung einer pragmatischen, dauerhaften und politisch mehrheitsfähigen Lösung.
Flexibilisierung vs. Ausdehnung
Die beiden Standesinitiativen, die nun weiterverfolgt werden, zielen darauf ab, den bestehenden Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaubs zu flexibilisieren. Anders gesagt: Sie verzichten darauf, die bisherige Urlaubsdauer auszudehnen. Damit stehen sie im deutlichen Gegensatz zur Familienzeit-Initiative, die im April 2025 lanciert wurde und je 18 Wochen Familienzeit für beide Elternteile fordert. Der heutige Mutterschutz von 14 Wochen wird ausgebaut zu neu 18 Wochen Familienzeit für die Mutter. Der zweite Elternteil soll ebenfalls 18 Wochen Familienzeit erhalten, um sich gleich lange um das gemeinsame Kind kümmern zu können. Ein Viertel der Zeit darf überlappend, drei Viertel der Zeit ist nicht übertragbar und muss nacheinander bezogen werden. Nur so werden gemäss aktueller Forschung Rollenbilder effektiv verändert. Die Initiative sieht 100 Prozent Lohnentschädigung für die tiefsten Einkommen vor.
Ringen um die Ausgestaltung
Für weitere Details können sich Interessierte auf den Websites von alliance F sowie der Familienzeit-Initiative informieren und dort auch unterschreiben. Damit ist klar: Zwanzig Jahre nach dem Durchbruch bei der Mutterschaftsversicherung steht mit dem Ringen um eine nationale Elternzeit die nächste wichtige familienpolitische Auseinandersetzung an.
Beitrag auf der Plattform Soziale Sicherheit (CHSS) vom 26. Juni 2025: «20 Jahre Mutterschaftsversicherung – der späte Durchbruch»
Medienmitteilung der nationalrätlichen Gesundheitskommission (SGK-N) vom 23. Mai 2025: «Kommission fällt erste Entscheide zur Reform der Witwen- und Witwerrenten»
Website der Familienzeit-Initiative