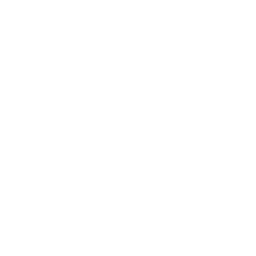Vielfalt leben – Zukunft stärken: kibesuisse am Bodensee-Symposium Frühe Kindheit
Wie kann Vielfalt in der frühen Kindheit konkret gelebt und gefördert werden? Beim Bodensee-Symposium Frühe Kindheit 2025 diskutierten Fachpersonen aus Wissenschaft und Praxis über Chancengerechtigkeit, Teilhabe und inklusive Bildung – mit inspirierenden Impulsen für Theorie und Praxis.
Am 13. und 14. Juni 2025 fand das 6. Internationale Bodensee-Symposium Frühe Kindheit an der Pädagogischen Hochschule Thurgau statt. Unter dem Titel «Vielfalt leben – Zukunft stärken» diskutierten Fachpersonen aus Wissenschaft und Praxis, wie Teilhabe, Chancengerechtigkeit und Zugehörigkeit in der frühen Bildung wirksam gefördert werden können. Das vielfältige Programm spannte den Bogen von Demokratiebildung in PEKiP-Gruppen über Medienkompetenz im digitalen Raum bis hin zur inklusiven Eingewöhnung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Besonders praxisnah waren Workshops zur Lernumgebung T-BOX oder zum Netzwerkmodell primano der Stadt Bern. Auch Fragen der Segregation in der Kindertagesbetreuung sowie die Potenziale mehrsprachiger Frühförderung wurden intensiv beleuchtet. Mit dem Symposium wurde einmal mehr deutlich, wie zentral der bewusste Umgang mit Diversität in der frühkindlichen Bildung für die gesellschaftliche Zukunft ist und wie stark Fachpersonen dazu beitragen können, Bildung von Anfang an gerecht und inklusiv zu gestalten.
Digitale Teilhabe beginnt in der frühen Kindheit
Im Rahmen des Bodensee-Symposiums Frühe Kindheit 2025 beleuchteten Andrea Kern (PH St. Gallen) und Jeanette Roos (PH Heidelberg) in ihrem Workshop, wie Kinderrechte, Medienkompetenz und Chancengerechtigkeit im digitalen Raum zusammengehören. Deutlich wurde: Digitale Bildung ist kein «Add-on», sondern ein grundlegender Bestandteil frühkindlicher Förderung. Im Zentrum stand das von den Referierenden entwickelte KiMe-Modell, das aufzeigt, wie Medienkompetenz kindgerecht, reflexiv und partizipativ aufgebaut werden kann. Anhand aktueller Studien wurden Risiken medialer Ungleichheit aufgezeigt – von ungleichen Zugängen im Elternhaus bis zu fehlender Ausstattung oder fehlenden Konzepten in Kitas. Teilnehmende diskutierten praxisnah, wie Schutz, Teilhabe und Befähigung digital ausbalanciert werden können.
Der Workshop setzte Impulse für eine differenzierte, kinderrechtsbasierte Medienbildung. Weitere Materialien zum Workshop:
- Fragen zur Umsetzung von Kinderrechten im digitalen Raum
- Leitsätze für eine kinderrechtsbasierte Medienbildung
Gleiche Bildung für alle? – Wie Partizipation und Segregation die Kita-Landschaft prägen
Im Impulsvortrag am zweiten Symposiumstag stellte Prof. Dr. Nina Hogrebe (TU Dortmund) die Frage nach der Gerechtigkeit im Zugang zu früher Bildung und legte eindrucksvoll dar, wie soziale Herkunft, Migrationshintergrund und strukturelle Hürden nach wie vor darüber entscheiden, welche Kinder eine Kita besuchen (können). Die Studienergebnisse basieren auf Daten aus Deutschland, lassen sich aber durchaus auch auf die Schweiz übertragen.
Ihr Vortrag zeigte: Familien sind oft nicht «schwer erreichbar», vielmehr sind Anmeldeverfahren, Platzvergabe und Informationslage vielerorts so gestaltet, dass gerade benachteiligte Familien systematisch ausgeschlossen werden. In der Schweiz kommt noch die schwierige Finanzierung hinzu. Verstärkt wird diese Ungleichheit durch eine soziale Segregation in den Kitas: Wo viele benachteiligte Kinder zusammentreffen, sinkt oft die pädagogische Qualität und die Vielfalt der Erfahrungen.
Hogrebe plädierte für eine armuts- und diskriminierungssensible Praxis in Kitas und für politische Verantwortung: durch sozialindizierte Ressourcenverteilung, transparente Platzvergaben und eine differenzreflektierte Ausbildung von Fachkräften.